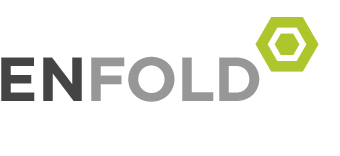Hormontherapie mit Unterbrechungen – Hat die Dauer der ersten Behandlungsphase Auswirkungen auf die Dauer der behandlungsfreien Zeit?
Das Deutsche Gesundheitsportal veröffentlichte in der 19. Woche eine Zusammenfassung eines Artikeln von Klotz et al. in dem Journal of Urology (Klotz L, Loblaw A, Siemens R, Ouellette P, Kapoor A, Kebabdjian M, Zhang L, Saad F; Canadian Urology Research Consortium. A phase II, randomized, multicentre study comparing 10 months versus 4 months of degarelix (Firmagon®) therapy in prolonging the off treatment interval in men with localized prostate cancer receiving intermittent androgen deprivation therapy for biochemical recurrence following radical local therapy. J Urol. 2018 Mar 10. pp: S0022-5347(18)42502-5.)
Eine Hormontherapie wird vor allem bei Prostatakrebs-Patienten mit weit fortgeschrittener Erkrankung als Dauertherapie durchgeführt. Dabei wird der Wirkstoff solange verabreicht, bis der Tumor nicht mehr auf die Behandlung anspricht und die Erkrankung fortschreitet.
Demgegenüber wird bei der intermittierenden Hormontherapie der Wirkstoff phasenweise gegeben, um die Nebenwirkungen der Hormontherapie so gering wie möglich zu halten. Ein weiteres Ziel ist es den Zeitpunkt, an dem die Hormontherapie ihre Wirkung verliert (Prostatakrebs wird kastrationsresistent), lange hinauszuzögern. Der Ablauf der intermittierenden Hormontherapie ist jedoch nicht immer einheitlich. Die Dauer der ersten Anwendung variiert zwischen 3 und 12 Monaten.
Ein Forscherteam aus Kanada untersuchte nun, ob sich die Dauer der ersten Therapiesitzung auf die Dauer der Pause zwischen den Sitzungen sowie auf den Zeitraum bis zum Erreichen des Ursprungswertes des Testosteronspiegels auswirkt. Hierzu untersuchten die Forscher 90 Männer mit Prostatakrebs, bei denen der PSA-Wert nach einer Operation oder Bestrahlung wieder angestiegen war. Auch sollten keine Knochenmetastasen vorliegen. Die Patienten wurden randomisiert einer von zwei verschiedenen Behandlungsgruppen zugewiesen. Während die eine Gruppe 4 Monate lang monatlich Degarelix (43 Patienten) bekam, erhielten die Patienten der anderen Gruppe diesen Wirkstoff zu Beginn 10 Monate lang (47 Patienten). Die erste Dosis betrug 240 mg, dann wurde sie auf 80 mg/Monat reduziert. Zu Beginn der Studie unterschieden sich die beiden Patientengruppen hinsichtlich relevanter Laborwerte – (z.B. PSA, Testosteron) nicht. Auch gab es keine Differenzen bis zum Erreichen des Normalwertes des Testosteronspiegels.
Interessanterweise spielte jedoch das Alter eine Rolle. Männer unter 65 hatten wesentlich kürzere behandlungsfreie Phasen. Auch erreichten ihre Testosteron-Werte schneller wieder den Normalbereich als bei älteren Männern.
Markant waren vor allem Unterschiede in der Lebensqualität. Sie war am Ende der Behandlung bei den Patienten mit einer kürzeren ersten Phase der Hormontherapie weniger eingeschränkt als bei denjenigen mit einer längeren ersten Phase.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Patienten, bei denen der Prostatakrebs nach einer Operation oder Strahlentherapie wieder zurückgekehrt, und die sich für eine Hormontherapie entscheiden, eine kürzere Anfangsphase der intermittierenden Hormontherapie bevorzugen sollten.